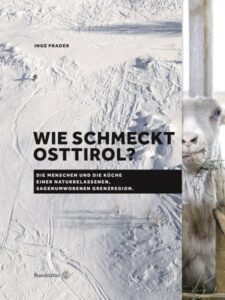Wer glaubt, dass das Ranggeln in Osttirol keine Tradition hätte, der irrt sich. Wer annimmt, dass Ranggeln über keine allzu lange Geschichte in ganz Europa verfügen würde, der ist gewaltig auf dem Holzweg. Macht euch also bereit viel zu lernen. Über Geschichte, Gegenwart und Zukunftsperspektive dieser hochinteressanten Sportart.
Bevor wir uns in die Gegenwart begeben, müssen wir weit zurückblicken. Sehr weit. Es wird wohl so in etwa das 13. Jahrhundert gewesen sein. Keltische Ringsportarten waren in diesem Jahrhundert bereits in ganz Europa verbreitet. Es gab schon Ritter, welche dieselben Ranggel-Techniken anwandten, die man auch im Hier und Jetzt noch findet.
Denn das ist wichtig. Beim Ranggeln geht es nämlich nicht darum, einfach mal wild drauflos zu, eben, „ranggeln“, sondern es kommt auf die Technik und die richtigen Griffe an. Begriffe wie Kreuzwurf, Ausheber, Axler, Knipfer, Hufer, Stierer und noch mehr begegnen einem in diesem Traditionssport. Im folgenden seht ihr ein kleines Video, das, obwohl falsch beschriftet, in Matrei in Osttirol aufgenommen wurde:
Aber nicht nur die Technik, sondern auch die Adjustierung ist streng geregelt. Die Ranggler trifft man mit kurzärmeligen Hemden an, die in der Mundart auch „Pfoad“ genannt werden. Der Stoff besteht aus festen Leinen mit Nylon vermischt. Die Farbe ist weiß. Ganz entscheidend ist der starke Ledergürtel. Tabu ist es hingegen, als Ranggler Schuhe zu tragen.
Jetzt wisst ihr schon einiges. Noch wissen müsst ihr, dass die Ranggelzeit in der allgemeinen Klasse sechs Minuten beträgt. Bei den Schülern und Jugendlichen 5 Minuten. Auch wo man ranggelt ist nicht beliebig. Es handelt sich meist um einen Kreis mit einem Durchmesser von 20-30 Metern im Freien. In der Halle muss der Ring mindestens 70 m² Kampffläche aufweisen. Natürlich gibt es auch Schiedsrichter, die alles genau im Blick haben. Bei verbotenen Griffen muss dieser sofort abpfeifen. Der Sieger wird „Hogmoar“ genannt. Das ist derjenige, der all seine Kämpfe gewinnt und als letzter übrigbleibt.
Ranggeln in Osttirol: Vergangenheit und Gegenwart
Kommen wir somit nach Osttirol. Genauer noch nach Matrei in Osttirol. Dort wurde der Traditionssport Endes des 18. Jahrhunderts heimisch. Es fanden erste Ranggler-Turniere statt.
Wir schrieben das Jahr 1963. In diesem Jahre wurde der Osttiroler Ranggler-Verein gegründet. Die Zeit seitdem war von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. 1996 nahm Franz Holzer die Führung der Sektion Ranggeln in die Hand. Natürlich braucht es aber nicht nur einen guten Obmann, sondern auch starke Partner und Unterstützer. Der wichtigste davon war und ist die Raiffeisenbank.
Zur Zeit der Übernahme durch Franz Holzer war es nicht allzu gut um diesen jahrhundertealten Traditionssport bestellt. Lediglich vier Ranggler waren damals noch aktiv. Das hieß für Franz Holzer natürlich, dass er seien Fokus auf eine gezielte und wirksame Nachwuchsarbeit richten musste. Das ist ihm ganz offensichtlich gelungen, denn im Jahr 2016 verfügt man über 40 aktive Ranggler in jeder Altersgruppe und Rangglerklasse. Im Heute darf man sich als beste Vereinsmannschaft im Alpenraum bezeichnen. In Tirol fällt einem lediglich der ähnlich gut aufgestellte Ranggler-Verein im Zillertal ein.
Im Jahr 2010 gab es gar die erfolgreichste Veranstaltung in der Vereinsgeschichte beim Länderranggeln in Kals am Großglockner. Mit 15 Preisträgern in 10 Klassen hat man nicht weniger als die Hälfte aller Preise gewonnen. Vier Erst-Platzierungen errangen dabei Kevin, Philipp, Simon und Josef Holzer.
Franz Holzer und das Ranggeln in Osttirol
Was aber braucht es, um wirklich ein Spitzen-Ranggler zu werden? Franz Holzer verrät es mir: „Viel Training. Zwei Mal die Woche zumindest. Auch daheim sollte man Kondition und Kraft noch trainieren. Vier Mal in der Woche wäre also optimal, wenn man wirklich ein Spitzen-Ranggler werden will!“.
Er verrät mir außerdem, dass die Ranggler früher aus eher bäuerlichen Verhältnissen gekommen seien. Heute sei es hingegen bunt gemischt. Der optimale Zeitpunkt um mit diesem Sport zu beginnen sei 7 Jahre.
Er empfinde die Mannschaft im Heute als sehr ausgeglichen, verrät mit der engagierte Obmann und bis vor wenigen Jahren aktive Ranggler Franz Holzer.
Was lässt sich abschließend übers Ranggeln in Osttirol sagen? Ganz sicher, dass diese Tradition erhalten bleiben muss. Es würde ganz schön was fehlen, wenn sich der Nachwuchs nicht mehr fürs Ranggeln interessieren würde. Die Sorge ist im Moment zum Glück unberechtigt. Denn den Nachwuchs findet man nicht primär über Inserate, sondern über Mundpropaganda. Es gilt somit die Begeisterung und die Liebe zu diesem Sport weiterzugeben. In den Händen von Franz Holzer gelingt das derzeit bestens.
Auf viele weitere Jahre Ranggeln in Osttirol!
Titelbild und Bilder: (c) Sportunion Matrei, Sektion Ranggeln
Der Beitrag Ranggeln in Osttirol: Ein Traditionssport mit großer Zukunft erschien zuerst auf Osttirol Blog.