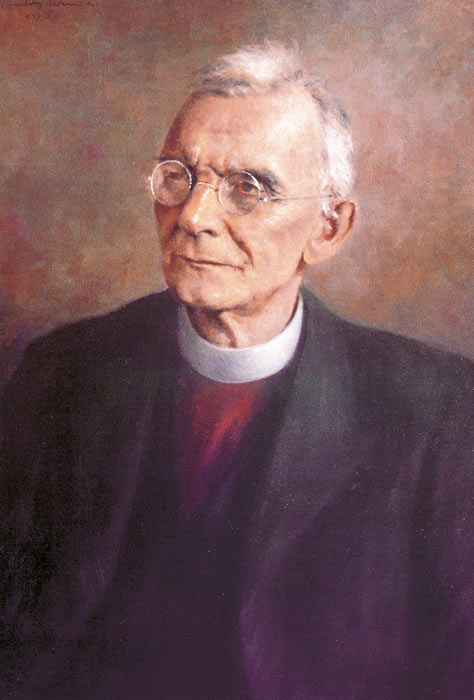Wer eine Wanderung plant, muss sich neben der Wetterlage, der Routenplanung, den Übernachtungsmöglichkeiten und anderes mehr auch mit der richtigen Bekleidung und Ausrüstung für seine Unternehmung beschäftigen.
Besonders bei Touren im hochalpinen Gelände ist es unabdingbar, sich mit diesem Thema sehr genau auseinanderzusetzen. Schon allein wegen schnell wechselnder Witterungsbedingungen und der Exponiertheit des Geländes kann das Vergessen eines wichtigen Ausrüstungsgegenstandes in dieser Höhe gefährliche Folgen haben. Denn auch im Hochsommer sind hier große Temperaturstürze innerhalb sehr kurzer Zeit möglich und das Wetter kann sehr schnell umschlagen – und dann wäre es fatal, wenn man etwa auf die Mitnahme von wärmender Bekleidung vergessen hätte.
Allgemeine Tipps zur Bekleidung und Ausrüstung
Wanderschuhe
Ein sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand für eine Wandertour sind die passenden Wanderschuhe. Um Blasen und Abschürfungen zu vermeiden, sollten diese gut eingelaufen sein, sonst kann man den Spaß am Wandern schnell verlieren. Im Hochgebirge sind jedenfalls robuste Wanderschuhe bis zum Knöchel bzw. sehr massive Bergschuhe (oftmals mit Steigeisen kombinierbar) zu empfehlen und bieten besten Halt in steinigem Gelände oder auf Schnee.
Rucksack
Beim Rucksack sollte man neben dem Gewicht auf eine gute Passform achten. Viele Hersteller von Wanderrucksäcken bieten auch speziell für Damen Rucksackmodelle an, die an die weibliche Anatomie angepasst sind.
Bekleidung
Beim Kauf der richtigen Bekleidung sollte man auf die Funktionalität, die Atmungsaktivität und die Trockeneigenschaften achten. Material, das nicht nur große Mengen an Feuchtigkeit aufnehmen kann und sich dabei trotzdem auf der Haut trocken anfühlt bzw. auch im feuchten Zustand den Körper wärmt, wäre hier optimal.
Wie sollte nun die Packliste ausschauen?
Die nachfolgende Packliste für eine Wanderung im hochalpinen Gelände soll dir helfen, an die richtige Bekleidung und an die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände bei einer Wanderung im hochalpinen Gelände zu denken. Achte auch darauf, dass du genügend Reserven (zB Fleecejacke, Wechselwäsche,…) im Gepäck hast. Obwohl prinzipiell das Gebot gilt: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“, solltest du keinesfalls bloß wegen einem etwaigen Gewichtsersparnis auf wichtige Ausrüstungsgegenstände bzw. Bekleidung verzichten. Lasse dich bereits bei der Auswahl und beim Kauf deiner Wanderausrüstung und Bekleidung in dem Sportgeschäft deiner Wahl gut über das Gewicht und die Funktionalität beraten. Die Packliste erhebt keinesfalls Anspruch auf Vollzähligkeit und kann natürlich nach eigenem Belieben erweitert und ergänzt werden.
Was soll ich tragen?
- Kurze, lange Berghose oder Zip-off Wanderhose
- Funktionsshirt
- Funktionsunterwäsche
- Wandersocken
- Kopfbedeckung/Stirnband
- Sonnenbrille
- aufgeladenes Handy
- Wanderstöcke
Optional
- Fleecepullover, Fleecejacke oder Softshelljacke (ansonsten im Rucksack)

Packliste für eine Wanderung im hochalpinen Gelände!
Was gehört alles in den Rucksack?
- Wechselwäsche (Funktionsshirt, -wäsche, -socken)
- Regenjacke/Hardshelljacke
- Regenhose
- Mütze + warme Handschuhe
- Gamaschen
- Verpflegung
- Trinkflasche / Thermoskanne
- Sonnen-/ Lippenschutz
- Erste-Hilfe-Set, Blasenpflaster
- Gebietsführer/Karten
- Kompass + Höhenmesser, Navigationsgerät oder Outdoor-Multifunktionsuhr
- Stirnlampe
- Biwaksack
- Bargeld und Ausweis(e)
- Regenhülle für den Rucksack
- Taschenmesser
- Streichhölzer/Feuerzeug
- Abfalltüte
- Toilettenpapier
Optional:
- Leichtsteigeisen
- Fotokamera
- Reserveakkus/Reservebatterien für Fotokamera, Navigationsgerät und Handy
Bei Hüttenübernachtung:
- Hüttenschlafsack
- evtl. Hüttenschuhe
- Toilettenartikel
- Medikamente (zB Aspirin)
- Ohropax (gegen schnarchende Hütten-Mitbewohner)
 Der Autor, Dietmar Ortner ist viel in den heimischen Bergen unterwegs und stellte seine zahlreichen Touren auf seiner Website www.tourenfex.at vor. Viele hochalpine Tourentipps mit Höhenprofil, Beschreibungstext und Bildern finden Sie auch auf der interaktiven Karte Osttirol auf maps.osttirol.com.
Der Autor, Dietmar Ortner ist viel in den heimischen Bergen unterwegs und stellte seine zahlreichen Touren auf seiner Website www.tourenfex.at vor. Viele hochalpine Tourentipps mit Höhenprofil, Beschreibungstext und Bildern finden Sie auch auf der interaktiven Karte Osttirol auf maps.osttirol.com.
Der Beitrag Gut ausgerüstet – Packliste für eine Wanderung im hochalpinen Gelände erschien zuerst auf Osttirol Blog.


















 . Somit bleiben alle Inhaltsstoffe erhalten und der Körper kann nach dem Winter die leeren Vitaminspeicher wieder auffüllen.
. Somit bleiben alle Inhaltsstoffe erhalten und der Körper kann nach dem Winter die leeren Vitaminspeicher wieder auffüllen.